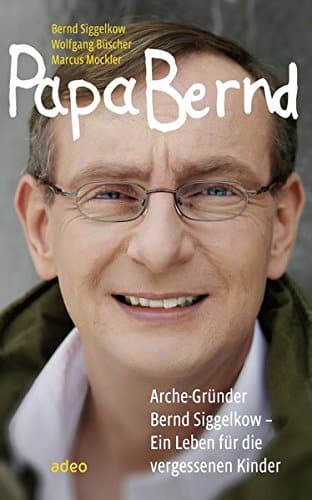
„Seine“ Kinder nennen ihn „Bernd das Brot“ oder auch „Papa Bernd“. Unter diesem Titel ist gerade seine Autobiographie erschienen, die er am Freitag in Düsseldorf vorstellte. Bernd Siggelkow ist Pastor und Gründer des christlichen Kinder- und Jugendhilfswerks „Die Arche“ in Berlin, die es inzwischen aber auch in vielen anderen deutschen Städten gibt. Er sprach mit uns über die Not vor der eigenen Haustür, die Aufgabe der deutschen Gesellschaft und über seinen Glauben, der ihm immer wieder neue Kraft gibt.
Wie kommen eigentlich Ihre eigenen Kinder damit klar, dass „fremde“ Kinder zu Ihnen „Papa Bernd“ sagen?
Vor zwei Jahren habe ich an der Fachschule für Sozialwesen meiner Tochter einen Vortrag gehalten. Die Studenten stellten genau die gleiche Frage wie Sie. Meine Tochter sagte da: „Als ich 13 war, gab es eine Woche in meinem Leben, in der ich zu jedem Kind gesagt habe „Das ist nicht dein Papa, das ist mein Papa!“ Heute will ich selbst Erzieherin werden, um das Gleiche für Kinder zu sein, was mein Vater für Kinder ist.“ Mittlerweile sind meine drei Ältesten alle in der Arche angestellt. Dadurch, dass wir sie damals mit in die sozialen Brennpunkte genommen haben und sie so den dortigen Problemen ausgesetzt waren, haben sie heute ein großes Verständnis für die Situation der Kinder, mit denen sie arbeiten.
Wünschen Sie sich manchmal, einfach ein „normaler“ Familienvater mit einem ganz gewöhnlichen Bürojob zu sein?
Nein, für mich ist ein Bürojob das Schlimmste, was es gibt. Familie ist dagegen das Beste, was es gibt. Ich habe eine Frau und sechs Kinder im Alter von elf bis fünfundzwanzig, die wie gesagt auch teilweise in der Arche engagiert sind. Familienleben ist also gleich Archeleben und für meine Familie ist Archeleben auch gleich Familienleben. Aber ich bin gerade viel zu viel mit der Administration der Arche beschäftigt. Lieber würde ich mehr Zeit bei den Kindern verbringen.
Wie viel Zeit haben Sie denn überhaupt noch für die Kinder in der Arche?
Weil ich mein Büro in der Arche habe, habe ich die Kinder ja direkt vor der Tür. Wenn dann manchmal Dinge passieren, die mich etwas frustrieren, beispielsweise ein schlechtes Telefongespräch, gehe ich zu den Kindern, um auf andere Gedanken zu kommen. Aber auch sonst versuche ich, mindestens anderthalb Stunden am Tag bei den Kindern zu sein – obwohl das natürlich viel zu wenig ist.
Was muss sich Ihrer Meinung nach in unserer Gesellschaft im Umgang mit Kindern verändern? Haben Sie konkrete Erwartungen an uns als Bürger?
In den letzten Jahren hat sich diesbezüglich ja schon einiges getan. Früher hatte ich immer das Gefühl, dass nur die Not in den anderen Ländern gesehen wird, aber nicht die vor der eigenen Haustür. Als die Arche gegründet wurde, waren die Leute erstaunt, wie wir in unserer Wohlstandsgesellschaft auf die Idee kommen, etwas für arme Kinder zu tun. In ihren Augen gab es Kinderarmut nur in Südamerika und Afrika. Aber ich denke, dass die Bevölkerung und die Politik heute schon viel mehr für dieses Thema sensibilisiert sind. Auch bezüglich der Flutkatastrophe in Pakistan merkt man, dass sich das Spendenverhalten vieler Leute verändert hat. Sie wollen den Bedürftigen dort helfen, sehen aber auch die Probleme hier in Deutschland. Das ist ein positiver Schritt nach vorne.
Wie schätzen Sie die Rolle von Christen dabei ein?
Ich glaube, dass wir Christen trotzdem oft kaum über unseren Tellerrand hinausschauen. Wenn wir uns als Christen und Kirchen stärker mit der Gesellschaftsentwickung beschäftigen würden, könnten wir dort arbeiten, wo wir wirklich gebraucht werden. Der Gründer der Heilsarmee hat gesagt: „Wenn die Menschen nicht in die Kirchen gehen, dann muss die Kirche zu den Menschen gehen!“ Wenn ich mich an den Menschen orientiere, natürlich ohne Gott aus den Augen zu verlieren, dann sehe ich auch, wo die Probleme sitzen und womit sich die Leute beschäftigen.
Man merkt das heute bei der Predigt am Sonntag im Gottesdienst. Man hört dem Pfarrer zu und denkt: „Was hat das den Menschen draußen zu sagen?“ Dieselbe Frage stellt sich mir manchmal. Ich habe viele Praktikanten, die aus christlichen Gemeinden kommen. Wenn wir gemeinsam überlegen, welches biblische Thema wir mit den Kindern durchnehmen wollen, kommen Ideen wie die Bergpredigt oder die Geschichte von David und Goliath.
Natürlich hat das ganz viel mit unseren Kindern zu tun, nur sollte man sich zuerst die Frage stellen, was bei unseren Kindern wirklich dran ist und womit sie sich beschäftigen. Dann kommt das, was ich zu sagen habe auch bei den Kindern viel besser an. Das sollten auch wir als Kirchen ernster nehmen.
Sie haben in Ihrem Buch geschrieben, dass Menschen, die selbst in ihrer Vergangenheit schwierige Erfahrungen gemacht haben, vielleicht im speziellen Maße dazu befähigt sind, sich im Arbeitsfeld der Arche einzubringen…
Ich glaube, dass es nicht wichtig ist, was man für einen Hintergrund hat. Wenn man natürlich selbst eine schwierige Vergangenheit hat, kann man vielleicht bestimmte Menschen besser verstehen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Aber wenn man vom Herzen seine Arbeit macht, spielt die eigene Geschichte eine Nebenrolle. Bei Sozialpädagogen, die sich bei mir bewerben, merke ich in der Regel sofort, ob die Arbeit bei uns für sie Beruf oder Berufung ist. Wenn ich weiß, dass ich berufen bin und dass ich ein Herz für die Menschen habe, dann kann ich jede Arbeit machen, die mir gut liegt, unabhängig von der Herkunft.
Würden Sie es dem Staat eigentlich zutrauen, dass er sich alleine um die „vergessenen Kinder“ kümmert, ohne die sozialen Initiativen, die es gibt?
Ich glaube, dass das große Problem unseres Landes ist, dass wir ein Dienstleistungsstaat sind. Die Leute müssen immer irgendwo hingehen, damit sie etwas bekommen. Sie outen sich mit ihren Problemen oder denen ihres Kindes und dann greift ein Sozialarbeiter in die Schublade und sagt: Hier ist die Antwort, das ist entweder Ritalin oder es ist die Tagesgruppe oder ähnliches.
Das Kind wird nicht mehr als Individuum betrachtet. Es wird mit seiner individuellen Problematik nicht gesehen und so gibt es auch keine individuelle Lösung. Ich glaube, das Problem des Staates ist, dass er da nicht das richtige Maß hat. Ich habe am Dienstag mit Frau von der Leyen auch genau über dieses Thema gesprochen. Wir brauchen vor allem Vertrauenspersonen, auf die sich die Kinder verlassen können und die die Hilfe dann speziell für sie umsetzen.
In Ihrem Buch „Deutschlands sexuelle Tragödie“ erzählen Sie viele erschreckende Geschichten von einzelnen Kindern. Was war Ihre Intention dabei? Wollten Sie schockieren?
In meinen ersten drei Büchern war mir sehr wichtig, dass ich den Menschen Einblick gebe in das Leben der Kinder, ohne sie vorzuführen, ohne ihren richtigen Namen zu nennen und ohne ihre tatsächliche Geschichte zu erzählen. Die Kinder und Jugendlichen sollen dadurch nicht verurteilt werden. Es soll gezeigt werden, welchen Umständen diese Kinder ausgesetzt sind. Natürlich schockiert im ersten Moment eine Geschichte von einem Kind, dem die Mutter beim Sex zuguckt. Aber wenn wir nicht darüber reden, dann wird es so sein, wie wir mit allen Problemen umgehen: Wir nehmen wahr, dass es diese gibt, aber bitte nicht in meiner Nachbarschaft oder vor der eigenen Haustür!
Die Wahrheit tut weh. Das ist traurig, aber wenn ich mich mit den Kindern auseinandersetze, dann muss ich mich auch mit Ihrer ganzen Realität auseinandersetzen, um letztlich auch Maßnahmen zu finden, wie ich ihnen helfen kann.. Man muss über Missstände reden, um Lösungen finden zu können, wie man Kinder auch schützen kann. Dazu haben unsere Bücher meines Erachtens einen Beitrag geleistet.
Viele Jungen und Mädchen, von denen Sie erzählen, sind in einer unglücklichen Situation, weil die Eltern nicht in der Lage sind, für ihre Kinder zu sorgen, weder finanziell noch emotional. Wie schaffen Sie es, diese Eltern nicht zu verurteilen?
Ich glaube, dass man sich einfach sagen muss, dass kein Mensch geboren ist mit dem Ziel, seine eigenen Kinder einmal zu vernachlässigen. Aber alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, sind durch etwas geprägt worden und viele eben auch negativ. Auch eine Mutter, die ihr Kind vernachlässigt, tut dies nicht grundlos. Ursprünglich hatte auch sie den Wunsch, eine gute Mutter zu sein. Durch schwierige Begegnungen und Beziehungen wurde dieser Traum zerstört.
Wenn ich heute Kinder in meiner Einrichtung frage, was sie sich für ihr Leben wünschen, sagen sie mir: „Ich möchte heiraten, ich möchte zwei Kinder, ich möchte ein Haus, ich möchte einen Hund und ich möchte ein tolles Auto.“ Das sind keine Klischees! Ein paar Wissenschaftler haben mir schon gesagt, dass Kinder so etwas gar nicht wollen. Doch, die Kinder, die ich kenne, wollen es so und deren Eltern wollten es auch, aber irgendwas ist in dieser Entwicklung schief gelaufen und ich kann sie nicht dafür verurteilen. Natürlich müssen sie sich zusammenreißen und müssen das Beste aus ihrer Situation machen, aber wenn man es nicht kann? Wenn man keine Hilfe hat?
Nehmen wir mal eine allein erziehende Mutter. Die muss für ihre Kinder da sein, wenn sie krank sind, und sie muss für sich selber da sein, wenn sie krank ist. An wen kann sie sich denn anlehnen? Hat sie keinen Glauben, hat sie keine Familie, bei denen sie sich anlehnen kann, dann ist sie ganz auf sich allein gestellt. Dann ist es doch klar, dass sie vielleicht irgendwann aufgibt. Was diese Menschen brauchen, sind verlässliche Personen, Freunde, Beziehungspartner. Es ist ganz schwierig, das den Leuten verständlich zu machen. Wir brauchen für alles einen Schuldigen. Entweder es ist Gott oder es ist der Staat oder es sind die Eltern.
Ich kann auch nicht meine Mutter verurteilen. Im Nachhinein finde ich es logisch, dass sie die Familie verlassen hat, weil meine Eltern gar nicht zusammen gepasst haben. Die hätten gar nicht heiraten dürfen, aber das war in den 60er Jahren nun einmal so. Dass wir dann aber als Kinder mit unserer kleinen Seele da standen und auf der Strecke geblieben sind, ist traurig. Sie hätten bestimmt manche Sachen anders machen können. Aber meine Mutter wollte sich auch verwirklichen. Sie hat jetzt eine tolle Familie und bei ihrem nächsten Kind hat sie alles richtig gemacht. Was will man da vorwerfen?
Was gibt Ihnen Kraft, mit den Dingen fertig zu werden, die Sie Tag für Tag erleben?
Wenn ein Kind erzählt: „Mama sagt, ich hätte dich lieber abtreiben sollen“ oder man sieht, wie verwahrlost manche Kinder leben, dann kommt man manchmal schon an seine persönlichen Grenzen. Für mich ist in solchen Situationen der wichtigste Ansprechpartner Gott, der sieht alles, aber petzt nicht. Das ist der große Vorteil. (lacht)
Für mich ist auch meine Familie eine wichtige Stütze, die mich immer wieder neu aufbaut. Außerdem bin ich kein Pessimist. Auch wenn ich eine traurige Geschichte erzähle oder schreibe, erlebt man mich eigentlich als fröhlichen Menschen, auch weil ich viel Fröhlichkeit zurückbekomme. Es ist ja nicht so, dass von den fast 3.000 Kindern, die wir jede Woche betreuen, jedes Kind immer nur schlechte Sachen erlebt. Wir versuchen ein Stück des Alltages der Kinder zu verbessern. Wir verändern nicht zu hundert Prozent ihr Leben, aber wir sind ein Teil der Lösung.
Ich glaube, dass man immer den ersten Schritt sehen muss und nicht nur, wie weit das Ziel noch weg ist. Wenn ich diesen ersten Schritt gehe und damit etwas für das Kind erreiche, dann habe ich viel bewirkt und das gibt mir Kraft. Abends, wenn ein Kind mich in den Arm nimmt und sagt „Tschüss, bis morgen“, dann weiß ich, dass ich ein Stück der Probleme mit habe lösen können und dann bin ich glücklich.
Oft bekomme ich von den Kinder positives Feedback und dann weiß ich auf einmal: Es ist nicht alles hoffnungslos. Ich musste auch einmal ein Kind beerdigen und das kann ich auch nicht mehr gut machen. Das war endgültig. Aber auf der anderen Seite geht es weiter und ich muss auch aus diesen Dingen lernen. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Wenn ich einfach den Kopf in den Sand stecken würde, dann würde es keine Arche geben.
Welches Erlebnis hat Sie während Ihrer Arbeit in der Arche besonders geprägt?
Es gibt jeden Tag irgendein besonderes Erlebnis mit den Kindern. Eins, das mich besonders berührt hat, war letztes Jahr, 2009, im Sommercamp. Abends beim Gute-Nacht-Sagen meinte ein Mädchen zu mir: „Sag mal, Bernd, liebst du uns eigentlich nur, weil du Geld dafür bekommst oder aus ganzem Herzen?“
Ich habe mich natürlich sofort gefragt, ob ich irgendeinen Fehler gemacht oder sie an diesem Tag nicht genug beachtet habe. Ein Kind stellt ja normalerweise nicht einfach solch eine Frage. Ich habe dann aus vollster Überzeugung zu ihr gesagt: „Ich liebe euch wirklich aus ganzem Herzen und nicht, weil ich irgendwelches Geld dafür bekomme.“ Und dann springt sie auf, nimmt mich in den Arm und sagt: „Das merkt man auch!“ In diesem Moment wusste ich, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
Vielen Dank für das Gespräch!
